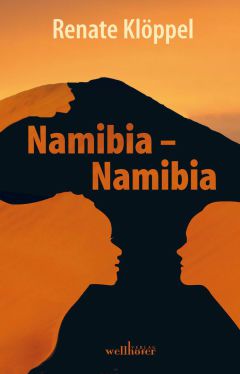Stumme Augen
Wir sehen uns jeden Tag. Er hält meinem Blick stand und weicht mir nicht aus, so wie es die meisten Menschen tun. Sie machen einen Bogen um mich, als ginge eine Gefahr von mir aus. Nur die Kinder sind anders. Sie bleiben stehen und glotzen mich an, als wäre ich ein Ungeheuer aus ihren Märchen, sie verharren mit offenen Mündern, bis jemand kommt und sie fortzieht.
Es ist furchtbar, in das Gesicht eines Mörder zu blicken, von dessen Tat niemand weiß. Es ist unerträglich, ihn täglich zu sehen und doch nichts tun zu können als zu warten, bis er auch mein Leben auslöscht. Mein Körper ist ein Kerker, der meinen Geist und meinen Willen gefangen hält. Hätte ich einen Wunsch frei – nur einen einzigen Wunsch – so würde ich nicht einen Moment zögern und mir wünschen sprechen zu können, sei es auch nur für einen Tag, ja, nur für eine Stunde.
*
Die Möbel, die drei kräftige Männer aus dem Wagen luden, sahen schäbig aus. Alle Möbel sehen schäbig aus, wenn sie auf der Straße stehen, dachte Manuel, wie Sperrmüll, den niemand mehr haben will. Auch seine eigenen. Er sollte sie bald ersetzen, jetzt, wo er der Besitzer eines Einfamilienhauses war. Einfamilienhaus klang gut, fand er, doch dies war ein dehnbarer Begriff. Seines war ein winziges Häuschen mit steilen Treppen und kleinen Fenstern, die nur wenig Licht in die nicht gerade großen Zimmer ließen. Es war auch keines von diesen bunt angestrichenen Schmuckkästen, die es in der Nachbarschaft gab, sondern lehnte wie ein Anhängsel an einem größeren Haus, als könne es nicht mehr aus eigener Kraft aufrecht stehen. Trotzdem war er stolz darauf und jetzt, wo die Renovierung abgeschlossen war, fühlte er sich stark und erfolgreich wie schon seit langer Zeit nicht mehr. Jahrelang hatte das Häuschen leer gestanden – wegen Erbstreitigkeiten hatte die Bank gesagt, in deren Besitz es zwischenzeitlich gelangt war.
Cornelia hatte das heruntergekommene Gebäude vor einem halben Jahr entdeckt und die Besitzerin ausfindig gemacht. Ihre Zuversicht, aus der Bruchbude ein schönes Haus in guter Lage für ein gemeinsames Leben auferstehen zu lassen, hatte ihn angesteckt. Der erste Anblick des Hauses von innen war allerdings selbst für Cornelias Optimismus ein Schock gewesen. Zwei Obdachlose hatten sich hier für Monate eingenistet. Ohne Strom, Wasser oder Heizung hatten sie im Erdgeschoss gehaust und den Müll von Monaten zurückgelassen. Auf der Rückseite hatten sie ein Fenster eingeschlagen und durch die mit Pappe zugeklebte Öffnung ein Ofenrohr nach draußen geführt. Die letzten Reste des verheizten Treppengeländers waren zerschlagen neben dem alten Kanonenofen zurückgeblieben, zu dem das Rohr gehörte. Die Toilette war schwarz von Kot gewesen und der Wasserkanister, der wohl einmal zum Spülen gedacht war, leer.
Manuel freute sich darauf, sein Leben als überarbeiteter Junggeselle aufzugeben, um mit Cornelia, ihrer bald neunjährigen Tochter Pauline und dem hinkenden Kater Herbert wie eine richtige Familie unter einem Dach zu leben. Pauline ließ allerdings keinen Zweifel daran, dass sie am liebsten mit ihrer Mutter allein geblieben wäre. Kurz nach ihrem ersten Zusammentreffen hatte er noch gehofft, dass sie eines Tages Papa zu ihm sagen würde. Später war er froh gewesen, wenn sie überhaupt ein paar Worte mit ihm wechselte. Jetzt war ihr größtes Entgegenkommen, ihn mit Manuel anzureden und nicht nur in der dritten Person über ihn zu sprechen.
Über seine Möbel hinweg fiel Manuels Blick auf die Einfahrt neben dem gegenüberliegenden Haus. Dort bewegte sich etwas. Von irgendetwas Unsichtbaren gesteuert fuhr ein Mann mit seinem Rollstuhl zielsicher aus einer Einfahrt heraus auf die schmale Straße. Jemand hatte ihn im Rollstuhl festgebunden und die Oberarme mit einem breiten Gurt neben dem Oberkörper fixiert. Der rechte Unterarm war verdreht und zur Seite gestreckt, während der linke vor der Brust gebeugt war. Beide Arme waren trotz ihrer Fesseln in fortwährender Bewegung. Auch die Hände bewegten sich, jeder einzelne Finger vollführte einen langsamen bizarren Tanz. Über die Oberschenkel war ein breiter Riemen gespannt. Selbst der Kopf des Mannes war über der Stirn mit einem Gurt fixiert und lehnte an einer Kopfstütze, die vom Hinterkopf bis zu den Schläfen reichte und die Rückenlehne des Rollstuhls überragte. Das ausgezehrte Gesicht unter den dunklen strähnigen Haaren verzerrte sich zu wilden Grimassen. Das Alter des Mannes? Seine ungezügelte Mimik hatte tiefe Spuren hinterlassen. Er konnte fünfzig sein, vielleicht aber auch zehn oder zwanzig Jahre jünger.
Manuel trat einen Schritt zurück und ließ den Mann in dem schmalen Durchlass passieren, der zwischen den Häusern und einem Möbelwagen frei geblieben war. Als sie auf einer Höhe waren, bewegten sich die Arme des Mannes heftiger, und für einen Moment schienen sich ihre Blicke zu begegnen. Vielleicht versuchte der Mann zu sprechen, aber es drangen nur unverständliche gurgelnde Laute aus seinem Mund. Dann war der Kranke vorüber. Mehr verwundert als entsetzt sah ihm Manuel nach, wie er an den niedrigen Häusern vorbei in Richtung der Kirche St. Urban weiterrollte. Erst als Autos den Mann verdeckten, wandte er sich dem Haus zu, aus dem der Behinderte gekommen war. Dort hielt an einem Fenster im ersten Stock eine magere Hand die Gardine ein Stück zur Seite. In dem Spalt erschien mit langsamen und eckigen Bewegungen eine gebeugte Gestalt mit kahlem Schädel. Das Gesicht eines Greises näherte sich der Fensterscheibe. Reglos starrte der Alte zu Manuel hinunter. Als sich ihre Blicke kreuzten, ließ der Alte die Gardine los, die sich sofort wieder schloss.
Manuel drehte dem nun hinter der Gardine lauernden Alten den Rücken zu. Keine Frage, Herdern war eng hier, ein Dorf in der Stadt Freiburg, in dem früher Winzer und Bauern lebten, mit Dorfbach, Kirchplatz und ein paar wenigen dem Bauboom trotzenden kleinen Häuschen. Achtzehntes Jahrhundert schätzte er deren Alter. An dieser Stelle gab es keine noblen Anwesen wie die Häuser in Hanglage, keine Jugendstilvillen, wie anderswo in Herdern. Aber immerhin war das hier ein Einfamilienhaus, was im Stadtgebiet von Freiburg eine Seltenheit war.
*
Bis zum Nachmittag hatte Manuel seine mehr als tausend CDs nach Komponist und Musikgattung geordnet im Regal einsortiert und seine Kleidung und Wäsche in den Schrank geräumt, dann hatte er keine Lust mehr. „Ich gehe zum Bäcker“, sagte er. „Soll ich euch etwas mitbringen?“
Cornelia wünschte Zwetschgenkuchen. Pauline sah ihn mit offenem Mund an, als sei sie überrascht, dass der Freund ihrer Mutter zu irgendetwas nützlich sein konnte. „Einen Berliner“, sagte sie und blickte wieder an ihm vorbei.
Als Manuel aus der Haustür trat, stand draußen am Zaun ein großer dünner Mann, die Finger beider Hände in den rostigen Maschendraht gehakt. Er trug ein schwarzes T-Shirt und auf dem Kopf eine graue Wollmütze, obwohl es nicht kalt war. Auf den ersten Blick sah es aus, als trüge er unter dem schwarzen Hemd noch ein enges blau, grün und rot gemustertes Trikot, das bis zu seinen Fingerspitzen reichte. Auf den zweiten Blick erkannte Manuel, dass die Haut an Armen und Beinen vollständig mit Tätowierungen bedeckt war. Der Kerl stand nur ein paar Meter von ihm entfernt und spähte angestrengt durch den Draht. Irgendetwas schien ihn besonders zu interessieren und Manuel war sich nicht sicher, ob es der verwilderte Garten war oder das Gartenhäuschen, vielleicht auch etwas ganz anderes. Der Mann ließ den Zaun los, machte ein paar Schritte nach rechts, dann nach links, ohne auf die wuchernden Brennnesseln zu achten, so als suche er eine günstige Position für irgendetwas. Jetzt bemerkte er, dass er beobachtet wurde und wandte sich mit einer hastigen Bewegung um. Manuel fror plötzlich, als habe ihn ein eisiger Windhauch getroffen. Das Gesicht des Mannes war eingefallen wie bei einem Verhungernden und die großen dunklen Augen lagen tief in ihren Höhlen. Unter seinen kantig vorstehenden Wangenknochen wanden sich zwei blaue Schlangen, und nach seiner Stirn griff etwas, was aussah wie die Hand eines Monsters oder ein abgerissenes Stück vom Flügel einer Fledermaus. Am Hals des Mannes hockte vom Ohr bis zum Kehlkopf eine dicke behaarte Spinne umgeben von Honigwaben statt eines Spinnennetzes. Der Schöpfer der Tattoos musste ein Meister seines Fachs sein.
„Schon gut“, sagte der Tätowierte, als müsse er Manuel beschwichtigen. Er drehte sich um und ging mit schlenkernden Armen so rasch davon, als habe er ein Ziel, das er schnell erreichen musste.
Manuel ging zu der Stelle, wo eben noch der Tätowierte gestanden hatte, und versuchte vergeblich zu erkennen, was den an ihrem Garten so interessiert haben konnte. – Der Garten, so nannte jedenfalls Cornelia das kleine Grundstück auf der Rückseite des Hauses. Er hingegen fand, zu einem Garten gehörten Blumen und Sträucher oder Rasen oder wenigstens eine Blumenwiese. Aber nichts von alledem gab es hier. Trümmergrundstück wäre der passende Ausdruck gewesen. Oder Schutthaufen. Dort, wo das Grundstück nach wenigen Metern an dem steiler ansteigenden Hang endete, lagen von Gestrüpp überwucherte bemooste Sandsteine, die einmal zu einer Begrenzungsmauer gehört haben mochten. Daneben vermoderten Teile eines alten Bretterzauns und allerlei Gerümpel, das irgendjemand hier abgeladen hatte, als solle es dem übrigen Unrat Gesellschaft leisten. In der hinteren Ecke des verwilderten Grundstücks stand ein windschiefes Gartenhäuschen, dessen Tür mit einem Vorhängeschloss gesichert war. Durch die schmutzigen Scheiben hatte er gesehen, dass dort Gartenstühle abgestellt waren, deren Polsterauflagen grau vom Schimmel waren.
„Den Garten bepflanzen wir erst im Herbst“, hatte Cornelia gesagt, als die Handwerker das Haus in Angriff nahmen. Jetzt war Herbst, aber pflanzen konnte man hier noch lange nicht. Man brauchte Leute, die zupacken konnten und die sich mit der Anlage eines Gartens auskannten, aber die kosteten Geld. Doch zum ersten Mal seit dreißig Jahren reichte seines nicht einmal für einen Gärtner. Diese Erkenntnis war niederschmetternd.
*
Am späten Abend ging Manuel wieder in den Keller, um noch ein paar von den vollen Kartons verschwinden zu lassen. Im Regal war kein Platz mehr. Er durchsuchte den Keller nach einer Möglichkeit, den Karton hier unten zu lassen, ohne ihn auf den feuchten und fleckigen Boden zu stellen. Er hätte sich die Zeit nehmen müssen, um die verkommene Unterwelt des Hauses zu entrümpeln, dachte er, wenigstens das, wenn schon die Wände feucht blieben und der Boden fleckig. Überall hatten ihre Vorgänger nicht mehr benötigte Dinge zurückgelassen, wahrscheinlich seit Generationen. Auf einem niedrigen Schuhregal aus rohem Holz, auf dem zwei Paar schmutzige Gummistiefel und etliche verschimmelte, längst aus der Mode gekommene Damenschuhe zurückgeblieben waren, stellte er den Karton ab und sah sich um. Hier unten gab es Ecken und Durchlässe, die ihm bei den ersten Besichtigungen der dunklen Kellerräume nicht aufgefallen waren. Als sein Haus an das Nachbarhaus angebaut wurde, waren die Keller der beiden Gebäude aus irgendwelchen Gründen offenbar verbunden worden. In einer Wand war einen halben Meter über dem Boden eine Öffnung wie für eine Tür, aber viel niedriger. Von oben wurde der Durchlass weiter eingeengt durch Rohre, die hier horizontal entlang der Wand verliefen. Er kletterte durch die Öffnung und gelangte in einen etwas höher gelegenen Keller, in dem er nur tief gebückt stehen konnte. Die Höhe des Raumes hätte vielleicht für Pauline gereicht, aber selbst Cornelia hätte nicht aufrecht stehen können. Er betastete die Wand neben dem Durchlass. Genau wie in den anderen Kellerräumen fand er hier eine dieser schwarzen Bakalitdosen mit einem Schalter zum Drehen, wie es sie schon vor einem halben Jahrhundert im Keller seines Elternhauses gegeben hatte. Eine mit einem Drahtkorb geschützte und von staubigen Spinnweben eingehüllte Lampe erleuchtete notdürftig den niedrigen Raum. Er wunderte sich wie groß und verwinkelt das Untergeschoss war. Spätestens hier konnte er nicht mehr unter seinem eigenen Haus sein. Tief gebückt durchquerte er den niedrigen Raum und kam zu einer Lattentür, deren Scharniere aus der Wand herausgebrochen waren. Offenbar war die Tür gewaltsam geöffnet worden. Auch hier fand er einen Lichtschalter. Er drehte ihn, aber das Licht funktionierte nicht. Im Halbdunkel erkannte er eine massive Kommode von ungewöhnlichen Ausmaßen: fast zwei Meter breit und einen Meter tief mochte sie sein, somit nahezu so groß wie ein Bett. Sie musste hier unten aufgebaut worden sein, ein Transport über eine Kellertreppe und durch die Türen wäre unmöglich gewesen. Er forschte nicht weiter, wohin ihn der nächste Durchlass führen würde und trat den Rückweg an. In der Stille der Nacht hatten die dunklen Räume etwas Gespenstisches. Hier unten fühlte er sich bedroht, ohne eine Erklärung dafür zu haben.
Ehe er seinen Platz im breiten Doppelbett einnahm, öffnete er leise die Tür zu Paulines Kinderzimmer. Ihr Nachtlicht, ein leuchtender Bär aus Kunststoff, tauchte den Raum in ein bläuliches Licht. Pauline schlief hinter einem kleinen Gebirge, das sich vor ihrem Bett auftürmte: mindestens ein Dutzend Kuscheltiere, Stapel von Comics, etliche Puppen, ein Lerncomputer und was sie noch in ihrer Nähe brauchte. Wahrscheinlich half ihr das, die fremde Umgebung vertrauter zu machen. Am Boden neben dem Kopfende des Bettes saß weiß wie ein Gespenst ein riesiger Plüschbär, den sie im vergangenen Frühjahr beim Jahrmarkt gewonnen hatte, und natürlich war Herbert bei ihr. Zusammengerollt lag er am Fußende und ließ ein leises Schnarchen hören, das kaum anders klang als sein Schnurren bei Tag. Manuel betrachtete das ruhig schlafende Kind und plötzlich überfiel ihn ein solches Vorgefühl eines Unglücks, dass sich eine Gänsehaut vom Rücken über den ganzen Körper ausbreitete. Er lauschte auf Paulines ruhige Atemzüge, und wie eben im Keller fragte er sich vergeblich, was ihn so ängstigen mochte. Als er die Tür leise wieder schloss, spürte er sein Herz, das wie ein Hammer in seiner Brust schlug. Draußen fiel eine Autotür mit einem Knall ins Schloss. Er fuhr zusammen und hätte fast aufgeschrieen. Er schüttelte verwundert den Kopf. Was war los mit ihm, dass er plötzlich so empfindlich war? War es die neue Verantwortung, die er übernommen hatte oder lag es an diesem Haus? – Wahrscheinlich hatte er heute nur zuviel gearbeitet.
*
Seit ich den Toten gesehen habe, ist mein Leben voller Angst vor dem Mörder. Ich bin nicht schwachsinnig, ich sehe nur so aus, und er weiß das. Er ahnt, dass ich ihm gefährlich werden kann, ich allein und niemand sonst. Deswegen wird er mich töten. Bin ich verrückt, weil ich glaube, dass er mein Mörder sein wird? Erst im letzten Augenblick meines Lebens werde ich es wissen. Wer durch Mörderhand stirbt, ich meine, wer sofort tot ist, muss nicht mit der Erinnerung an das Entsetzliche leben. Ist der Gedanke banal? Er ist es nicht. Wenn ich mich vor meinem Mörder fürchte, vergesse ich, wie kurz, wie vergänglich das letzte Grauen ist. Was folgt, ist eine tiefe Ruhe, ist gar nichts mehr. Was kann ich mehr wollen als das? – Warum fürchten wir den Tod? Der Tod ist kein Ereignis des Lebens, denn der Tod ist nicht, wo das Leben ist, und wo der Tod ist, gibt es kein Leben.
Seit dem ersten Tag meines Lebens haben andere über mich bestimmt. Jedes Aufstehen am Morgen, jedes Zubettgehen, jede Mahlzeit, jedes Verlassen des Hauses wird von anderen vorgegeben, warum nicht auch der Zeitpunkt und die Art meines Todes? Ich kann mich nicht wehren.